AgriWeedClim: Neue Unkrautarten unter dem Einfluss von Klima- und Landnutzungsänderungen in Mitteleuropa
Zusammenfassung
Die Landwirtschaft wird von unterschiedlichen Faktoren, wie z. B. Klimawandel, veränderter Flächennutzung und zunehmender Intensivierung der Landnutzung, beeinflusst. Diese Faktoren wirken sich auch auf Unkrautarten aus. Neue Unkrautarten kommen nach Mitteleuropa und verursachen erhebliche Ertragsverluste und Bekämpfungskosten. Mit dem Projekt AgriWeedClim wurden die Veränderungen der Unkrautflora in Mitteleuropa untersucht. Es wurde eine Datenbank (AgriWeedClim database) mit Vegetationsaufnahmen von Äckern aufgebaut und analysiert. Die Verbreitung ausgewählter Unkräuter in Mitteleuropa wurde unter vier Klimaszenarien modelliert und ihre potenzielle Ausbreitung bis zum Jahr 2100 prognostiziert. Es wurden Empfehlungen ausgearbeitet, um die Ausbreitung und die negativen Folgen dieser Unkräuter zu minimieren.
Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projekt AgriWeedClim wurden historische Veränderungen der Zusammensetzung von Unkrautgesellschaften in Mitteleuropa untersucht. Diese wurden durch Veränderungen in der Landnutzung, der Einschleppung gebietsfremder Arten und den Klimawandel verursacht. Es wurden die Fragen beantwortet, welche Unkrautarten in der Vergangenheit abgenommen, zugenommen oder sich neu etabliert haben. Dadurch wurden Schlüsselfaktoren, die zu den Veränderungen in der Zusammensetzung der Unkrautflora führten, identifiziert. Aus diesen Ergebnissen wurden die wichtigsten neuen und aufkommenden Unkrautarten ermittelt und die zukünftige Verbreitung dieser Arten basierend auf Landnutzungs- und Klimawandeltrends prognostiziert. In einem nächsten Schritt wurden Risikogebiete für neue und aufkommende Unkrautarten identifiziert. Zusätzlich wurde ein Maßnahmenpaket für die Begrenzung der künftigen Verbreitung bereitgestellt und die Auswirkungen der neuen und aufkommenden Unkrautarten auf die Landwirtschaft beschrieben.
Ergebnisse
Es wurde eine Datenbank (AgriWeedClim database) aufgebaut, in der sich zurzeit mehr als 32.000 Vegetationsaufnahmen von Äckern aus Mitteleuropa befinden. Darüber hinaus wurden verschiedene Daten (z.B. ökologische Indikatorwerte, biogeografischer Status) zu den einzelnen Unkrautarten gesammelt. Die Analysen zu den Veränderungen der Unkrautflora zeigen, dass in den letzten 90 Jahren die Unkrautflora in Mitteleuropa deutlichen Veränderungen unterworfen war. Die Zu- und Abnahme (species turnover) der Unkrautarten ist sehr ausgeprägt. Es wurden neue und aufkommende Unkräuter identifiziert, die deutliche Ertragsverluste und Bekämpfungskosten verursachen können. Insbesondere kommen Unkrautarten häufiger vor, die eine Vorliebe für nährstoffreiche Standorte haben. In dieser Analyse konnte auch bestätigt werden, dass Neophyten eine sich zunehmend ausbreitende Gruppe sind. Im Rahmen des Projekts wurde außerdem eine österreichweite Onlinebefragung unter 181 landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt. Aus dieser Befragung geht hervor, dass die Betriebe eine Veränderung der Unkrautflora auf ihren Betrieben wahrnehmen. Die Mehrheit der befragten Betriebe gibt an, dass vorher unbekannte Unkrautarten auf den Äckern vorkommen. 15 neue und aufkommende Unkrautarten (12 Arten und 3 Gattungen) wurden identifiziert. Arten, denen Beachtung geschenkt werden muss sind beispielsweise Ragweed, Aleppohirse, Erdmandelgras, Stechapfel und Staudenknöterich-Arten.
Die Auswirkungen des Klimawandels auf diese Unkräuter wurde unter vier Klimaszenarien modelliert und in vier Zeitschritten (bis zum Jahr 2100) projiziert, um potenzielle Verbreitungsgebiete in Österreich und Mitteleuropa zu veranschaulichen. Die Projektionen zeigen, dass die modellierten Arten ein beträchtliches Verbreitungspotenzial in Mitteleuropa haben, wobei die Ausdehnung der geeigneten Gebiete zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen kann. In Österreich befinden sich stark betroffene Anbauregionen in der Südoststeiermark, im Wein- und Waldviertel sowie im Innviertel unter gegenwärtigen Klimabedingungen.
Nutzen des Projekts
- Landwirtschaftliche Betriebe/Beratung werden in der Lage sein, neue und aufkommende Unkrautarten zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen.
- Neue Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Landnutzungsänderung auf die Verbreitung von Unkrautarten in der Landwirtschaft und die von ihnen verursachten Auswirkungen.
Projektdetails
Projekttitel: Neue Unkrautarten unter dem Einfluss von Klima- und Landnutzungsänderungen in Mitteleuropa
Projektakronym: AgriWeedClim
Projektleitung: Universität Wien
Projektleitung AGES: Dr. Swen Follak, Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion
Projektpartner: Universität Wien, Masaryk-Universität (Brno)
Finanzierung: KPC - ACRP
Projektlaufzeit: 11.2021 bis 11.2024
Publikationen
Glaser M., Berg C., Buldrini F., Buholzer S., Bürger J. & Chiarucci A. et al. (2022): AgriWeedClim database: A repository of vegetation plot data from Central European arable habitats over 100 years. Applied Vegetation Science 25(e12675), 1–13, doi: 10.1111/avsc.12675.
Glaser M., Dullinger S., Moser D., Wessely J., Chytrý M., Lososová Z., Axmanová I., Berg C., Bürger J., Buholzer S., Buldrini F., Chiarucci A., Follak S., Küzmič F., Meyer S., Pyšek P., Richner N., Šilc U., Steinkellner S., Wietzke A., Essl F. (2024): Pronounced turnover of vascular plant species in Central European arable fields over 90 years. Agriculture, Ecosystems and Environment 361, 108798, https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108798.
Follak S., Glaser M., Griesbacher A., Essl F. (2024): Crops gone wild – weedy Helianthus annuus in Austria. BioInvasions Records 13, 565–576.
Follak S., Chapman D., Schwarz M., Essl, F. (2023): An emerging weed: rapid spread of Solanum carolinense in Austria. BioInvasions Records 12, 649–658.
Glaser M., Essl F., & Follak S. (2024). Austrian farmers perception of new weeds. Plant-Environment Interactions 5, e10129. https://doi.org/10.1002/pei3.10129
Follak S., Essl F., Glaser M. (2023): Unkrautflora im Wandel. Der Pflanzenarzt 76(11-12), S. 7–9.
Glaser M., Follak S., Essl F. (2024): Wie gehen heimische Betriebe mit den „Neuen“ um? Die Landwirtschaft Mai/2024, 34–35.
Weitere Informationen
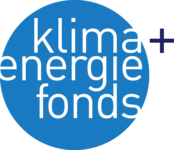
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „ACRP“ durchgeführt.
Aktualisiert: 29.01.2025